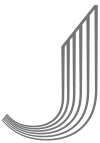Mit Wirkung zum 1. Juli 2025 wurde die Novelle des Bürgerlichen Gesetzbuches in Kraft gesetzt, welche erstmalig eine gesetzliche Definition von häuslicher Gewalt ausdrücklich einführt. Die neue Bestimmung des § 3021 stärkt den Schutz der Opfer nicht nur symbolisch, sondern auch praktisch – insbesondere bei Scheidungen und Vermögensauseinandersetzungen.
Was gilt laut Gesetz als häusliche Gewalt?
Häusliche Gewalt ist laut Bürgerlichem Gesetzbuch ein Verhalten, das Machtmissbrauch darstellt und die körperliche oder geistige Unversehrtheit, Freiheit, Würde oder Privatsphäre des Opfers beeinträchtigt. Es kann physischer, psychischer, sexueller oder wirtschaftlicher Natur sein. Dazu gehören auch Situationen, in denen die Fähigkeit des Opfers, die grundlegenden Lebensbedürfnisse für sich selbst oder die Mitglieder seines Haushalts zu sichern, ernsthaft gefährdet ist.
Wer gilt als Opfer?
Das Gesetz schützt nicht nur Partner, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, sondern auch ehemalige Ehegatten oder Partner, Eltern gemeinsamer Kinder, Personen mit geteilter elterlicher Verantwortung und sogar diejenigen, die vom Täter wiederholt und über längere Zeit aufgesucht werden.
Auswirkung auf die Vermögensauseinandersetzung nach der Scheidung
Eine wesentliche Neuerung besteht darin, dass häusliche Gewalt bei der Vermögensauseinandersetzung der Ehegatten rechtlich relevant wird. Gemäß § 742 Abs. 1 Buchst. g) kann das Gericht die Art, Schwere und Dauer des gewalttätigen Verhaltens berücksichtigen und eine ungleiche Aufteilung des Vermögens zugunsten des Opfers beschließen.
Das Gericht wird die (Nicht-)Existenz häuslicher Gewalt und damit auch die Frage, inwieweit die Ausgleichsanteile bei der Vermögensauseinandersetzung angepasst werden sollen, selbständig als präjudizielle Frage prüfen.
Praktisch wird diese Bestimmung jedoch nur in Fällen zur Anwendung kommen, in denen eine der Streitparteien angibt und nachweist, dass häusliche Gewalt oder eine vorsätzliche Straftat begangen wurde. Die Rechtsprechung des Obersten Gerichts hat bereits früher anerkannt, dass gewalttätiges Verhalten bei der Vermögensauseinandersetzung berücksichtigt werden kann (z. B. Urteile Az. 22 Cdo 1137/2012 und 22 Cdo 999/2011). Die Novelle überträgt diese Regel ausdrücklich in das Gesetz.
In der Praxis kann beispielsweise eine gemeinsame Wohnung ausschließlich dem Opfer mit Kindern zugewiesen werden.
Die sanktionsrechtlichen Folgen einer gerichtlichen Entscheidung
Die gerichtliche Entscheidung hat eindeutig einen Sanktionscharakter gegenüber dem Täter. Die Zuweisung einer Immobilie an das Opfer kann finanzielle Folgen im Umfang von mehreren Millionen bis zu Dutzenden Millionen Kronen nach sich ziehen. Ein solcher Eingriff in die Vermögenssphäre des Täters kann mitunter einschneidender sein als eine Geldstrafe im Strafverfahren. Die Novelle schützt somit nicht nur die Opfer, sondern hat zugleich eine abschreckende Wirkung, die potenzielle Täter von weiterer Gewalt abhalten kann.
Schnittstellen mit dem Strafrecht
Der Begriff „häusliche Gewalt“ ist im Strafgesetzbuch nicht enthalten, es arbeitet mit dem Straftatbestand der Misshandlung einer nahestehenden Person (§ 199 StGB). Für diese Straftat droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu sechs Jahren, je nach Schwere des Falls.
Zivile vs. strafrechtliche Sanktionen
Die Novelle des Bürgerlichen Gesetzbuches führt eine neue Sanktion ein, die ausschließlich auf zivilrechtlicher Ebene wirkt. Dabei handelt es sich nicht um eine Strafe im herkömmlichen Sinne, sondern um eine spürbare finanzielle Konsequenz, wie etwa den Verlust eines Anteils an einer Immobilie. Paradoxerweise kann diese zivilrechtliche Konsequenz für den Täter härter sein als die strafrechtliche Sanktion selbst. Denn sie übersteigt in finanzieller Hinsicht oft die Höhe der von Gerichten verhängten Geldstrafen.
Eine Analyse der Entscheidungen der Prager Gerichte aus den Jahren 2015–2021 zeigt, dass in etwa 70 % der Fälle von Misshandlung einer nahestehenden Person bedingte Freiheitsstrafen gegen die Täter verhängt werden.
Sofern eine detaillierte Überwachung ihres Verhaltens erforderlich ist, wird die Aufsicht des Bewährungs- und Mediationsdienstes hinzugefügt. Unbedingte Freiheitsstrafen werden meist nur bei schwerwiegenderen Tatformen verhängt – etwa bei länger andauernder Gewaltanwendung oder bei schweren Gesundheitsschäden. Anders gesagt, die Strafjustiz wählt oft auch hinsichtlich der Freiheitsentziehung einen milderen Weg.
Was ist in der Praxis zu erwarten?
Die weit gefasste Definition von häuslicher Gewalt gibt den Gerichten die Möglichkeit, flexibel zu reagieren. In der Anfangsphase wird jedoch erwartet, dass die Gerichte zurückhaltend vorgehen und nur in schwerwiegenden Fällen wesentliche Auswirkungen auf die Vermögensaufteilung zulassen. Klarere Konturen werden sich erst mit der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs ergeben, was einige Jahre dauern wird.
Wenn Sie an Neuigkeiten aus anderen Rechtsgebieten interessiert sind, abonnieren Sie bitte unseren Newsletter unten rechts auf der Seite.

Mgr. Romana Šimáně | Rechtsanwältin